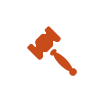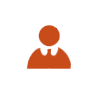Wem gehört das Auto im Kronkorken?
Das Landgericht Arnsberg musste sich mit der Frage beschäftigen, wem der Gewinn zusteht, der sich in einem Kronkorken in einem von zwei "Wochenend-Bierkästen" befand.
Fünf Freunde hatten einen gemeinsamen Wochenendausflug geplant und zu dessen Vorbereitung auch zwei Bierkästen eines namhaften Bierproduzenten beschafft. Die Kosten der Unterbringung und Verpflegung wurde unter den Freunden gleichmäßig aufgeteilt.
Es kam, wie es kommen musste. In einem der Kronkorken auf den gemeinsam angeschafften Bieren befand sich der Hauptgewinn, ein Audi A3 sportsback. Diese Kronkorken riß sich einer der fünf Freunde unter den Nagel und löste den Gewinn ein. Den Gewinnerwage fuhr er dann einige Zeit und verkaufte diesen dann.
Einer der fünf Freunde sah sich benachteiligt und erhob Klage und bekam im Ergebnis Recht, wenn auch nicht in dem beantragten Umfang.
Das Gericht musste nun entscheiden, wem der Gewinn zusteht. Dies tat es dergestalt, als dass es fragte, wie die Eigentumsverhältnisse an dem Bierkasten zu bewerten sei. Da die Anschaffungskosten zwischen den Freunden geteilt wurde, sei sinngemäß ein Mitanspruch an dem Gewinn entstanden, so dass allen fünf Freunden ein Fünftel am Gewinn zustehe. Ausgeurteilt wurde aber nur ein Anspruch von einem Fünftel des Marktwertes und nicht des Wertes bei der Auslieferung.
Ich halte es nur für gerecht, dass der Gewinn geteilt werden muss, denn in dem hier entschiedenen Fall wäre es dem Zufall überlassen, wer den Korken entdeckt und an sich reißt. Wie sich zeigt, hat dieser Fall eine vorher bestandene Freundschaft zerstört. Ob die Parteien dies in die Kalkulation der Prozessrisiken einbezogen haben?
Ihr Rechtsanwalt Christoph Seiffert auf Flensburg